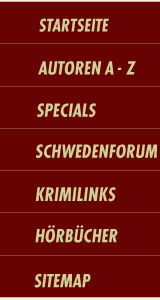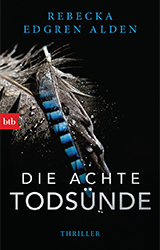Der Weltkrieg, werden wir niemals mit damit fertig? Nein, das werden
wir nicht. Er wird uns immer in Anspruch nehmen, auch die Schriftsteller,
so wie heute, 55 Jahre nach Ende des Krieges, sprudelt er immer noch
als sei er eine unversiegbare Quelle.
Der letzte in der Reihe ist Roy Jacobsen, einer unserer führenden
Schriftsteller, umsichtig in der Auswahl seines Themas, tiefgehend in
seiner Menschenschilderung, scharf in der Analyse sozialer Beziehungen,
ein Mann mit Fantasie, aber auch einer, der es genau wissen will, fanatisch
in seiner Jagd nach tatsächlichen Geschehnissen, aus denen er Erzählungen
schaffen kann.
In "Grenzen" holt er all das hervor, mischt Fakten mit Fiktion,
spielt gekonnt auf der Klaviatur - einiges erscheint sogar ganz neu.
Teile des Romans können als Kriegsreportage gelesen werden und
Jacobsen bekleidet die Rolle des Kriegskorrespondenten mit Bravour.
Als Reporter ist er nicht selbst zur Stelle, er spricht vielmehr durch
die Personen, die er an die wichtigsten Frontabschnitte versetzt hat
- an die Ostfront des Winters 1942/43, nachdem Hitlers siebte Armee
dabei war,
zusammenzubrechen unter dem Würgegriff der Russen und in die Ardennen
während des letzten Versuchs der Deutschen, sich gegen die alliierte
Invasion zur Wehr zu setzen.
Militärgeschichte
Auf diese Schilderung hat Jacobsen viel Energie verwandt. Er beschreibt
die äußeren Fakten, den großen Marsch der Militärgeschichte
sozusagen, so, wie wir sie kennen und zum größten Teil authentisch,
soweit ich (d.i. Øystein Rottem, Anm. d. Red.) das beurteilen
kann.
Der Roman zeugt von gründlichen Studien und solidem Können.
Vielleicht wird mancher Leser ermüden ob der vielen Informationen
über Truppenversetzungen und Pläne für den Rückzug
oder Angriff.
Ich (d.i. Øystein Rottem, Anm. d. Red.) empfinde das nicht so.
Denn selbst während der langen Erzählung vom Militärlager
Novotjerkassk am Don-Becken, die einen der Schwerpunkte des Romans ausmacht,
ist immer auch der Dichter zur Stelle - der, der am meisten am Menschen
im Krieg interessiert ist, mit all seiner Hoffnung und Verzweiflung,
Freude und Angst, Furcht um einen Sohn, der sich auf der anderen Seite
der Front befindet, Furcht vor der Niederlage, involviert und ausgeschlossen
zur gleichen Zeit.
So auch der Belgier Markus Hebel, Elektroingenieur und Offizier an der
Ostfront, ein Mann, mit wenig Verständnis für Hitlers Hirngespinste
über ein großgermanisches Reich. Ein Mann, der seine Pflicht
tut, einer, der nicht unter die Räder der Geschichte gerät,
sondern der zurückkehrt und
erzählen kann, der das aber nicht tut, jedenfalls nicht sofort,
der wählt, zu schweigen, der sich blind stellt - bis in die 60er
Jahre hinein, als er sein Geheimnis preisgibt und seine Geschichte dem
jungen Robert erzählt, einer weiteren Hauptperson des Romans.
Auch er ist ein Produkt des Krieges, empfangen während eines heftigen
Schusswechsels, eine extatische Atempause mitten im Wahnsinn des Krieges,
Sohn eines kanadischen Soldaten auf der Flucht und einer belgischen
Krankenschwester.
| Buchtipp |
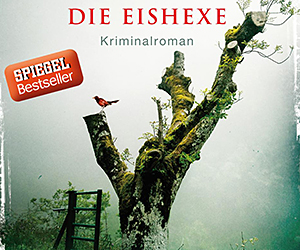 |
Robert wohnt zusammen mit seiner Mutter. Sie wohnen in der Nähe
von Hebel und seiner Frau, in Luxemburg, diesem Lilliputaner-Staat nahe
der deutschen Grenze, dessen Einwohner drei verschiedene Sprachen sprechen,
ein Mischstaat, der absolute Gegensatz zu den perversen
ethnischen Reinheitsidealen der Nazis.
Hier lebt man an Grenzen, ohne den Zwang, diese zu verändern, das
Sinnbild der Idee von der Zufälligkeit der Grenzziehung, so wie
sie in dem einleitenden Prolog über den Bauern zum Ausdruck kommt,
der auf der einen Seite der Grenze wohnt und sein Eigentum auf der anderen
Seite der Grenze hat und die Behörden um die Erlaubnis bittet,
eine Brücke zu bauen, damit er seine tägliche Arbeit verrichten
kann.
Alltag
Hier treffen wir eine Reihe Nachbarn und Zufallsbekanntschaften: Maria,
Roberts Mutter Nella, Markus' Frau Léon, auch ein Opfer des Krieges,
das schweigt, zwangsentlassener Soldat und Deserteur, seine "unechte"
Frau Agnes, den Vater Rampart und weitere mehr.
Hier sind wir zurück im Alltag, aber in einem Alltag im Schatten
des Krieges. "Grenzen" ist ein Roman über Grenzen zwischen
Nationen und zwischen Menschen. Nationen sind die Summe der Menschen,
die dort wohnen und Grenzen sind etwas vom Menschen geschaffene, etwas,
das bestehen bleiben oder verändert werden kann, etwas, das eine
Sperre sein kann, aber auch etwas, das überwunden werden kann -
eine abstrakte Fiktion in einer konkreten Landschaft.
Nachwirkungen
Der Roman handelt von Menschen, die nahe einer Grenze leben, von Menschen,
die in einem Krieg leben - und nach einem Krieg. Er handelt davon, was
der Krieg aus den Menschen macht, welche Nachwirkungen er mit sich zieht,
ein Roman über das, was man erinnert und das, was man niemals vergessen
kann, über das, was man am liebsten verschweigen und vergessen
will, über das, was man weiter erzählen will, damit es nie
wieder Krieg gibt und über das, was man verschweigen will - aus
dem selben Grund.
Übersetzung und redaktionelle Bearbeitung:
Alexandra Hagenguth/
© Oktober 2004 - Literaturportal schwedenkrimi.de - Krimikultur
Skandinavien |