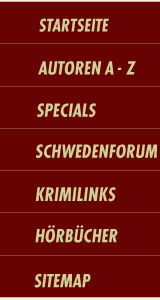Leseprobe Leseprobe
Wir wohnen im Weißen Schnitt.
Auf einem Grundstück, das man der Wohnungsbaugesellschaft geschenkt
hat, hat sie ein paar vorfabrizierte Schachteln aus weißem Beton
aufeinandergestapelt, für die sie vom Verein zur Verschönerung
der Hauptstadt eine Prämie erhalten hat.
Das Ganze, einschließlich Prämie, macht einen billigen und
notdürftigen Eindruck; die Mieten allerdings haben nichts Kleinliches,
sie sind so hoch, daß hier nur Leute wohnen können wie Juliane,
für die der Staat aufkommt, oder wie der Mechaniker, der nehmen mußte,
was er kriegen konnte, oder die eher marginalen Existenzen wie zum Beispiel
ich.
Die Leute haben offenbar sehr gut begriffen, was Leukotomie ist. So ist
der Spitzname für uns, die hier wohnen; das ist zwar verletzend,
im großen und ganzen aber korrekt. Es gibt Gründe dafür,
hier einzuziehen, und Gründe, hier auch wohnen zu bleiben. Mit der
Zeit ist das Wasser für mich wichtig geworden. Der Weiße Schnitt
liegt direkt am Kopenhagener Hafen. In diesem Winter konnte ich sehen,
wie sich das Eis bildete. Der Frost setzte im November ein. Ich habe Respekt
vor dem dänischen Winter. Die Kälte - nicht die meßbare,
die auf dem Thermometer, sondern die erlebte - hängt mehr von der
Windstärke und vom Feuchtigkeitsgrad der Luft ab als davon, wie kalt
es ist. Ich habe in Dänemark mehr gefroren als je in Thule. Sobald
die ersten klammen Regenschauer mir und dem November ein nasses Handtuch
ins Gesicht peitschen, begegne ich ihnen mit pelzgefütterten Capucines,
schwarzen Alpakaleggings, langem Schottenrock, Pullover und einem Cape
aus schwarzem Goretex.
Dann fällt die Temperatur allmählich. Irgendwann hat die Meeresoberfläche
minus 1,8 Grad Celsius, die ersten Kristalle bilden sich, eine kurzlebige
Haut, die der Wind und die Wellen
zu frazil Eis zerschlagen, das zu dem seifigen Mus verknetet wird, das
man Breieis, grease ice, nennt; es bildet allmählich freitreibende
Platten, pancake ice, das dann an einem Sonntag in einer kalten Mittagsstunde
zu einer zusammenhängenden Schicht gefriert.
Es wird kälter, und ich freue mich, denn ich weiß, daß
der Frost jetzt zugelegt hat, das Eis bleibt liegen, und die Kristalle
haben Brücken gebildet und das Salzwasser in Hohlräumen eingekapselt,
die eine Struktur haben wie die Adern eines Baumes, durch die langsam
die Flüssigkeit hindurchsickert; daran denkt kaum jemand, der zur
Marineinsel Holmen hinüberschaut, es ist aber ein Argument für
die Ansicht, daß Eis und Leben auf mehrfache Weise zusammenhängen.
Wenn ich auf die Knippelsbrücke komme, ist das Eis normalerweise
das erste, wonach ich Ausschau halte. An diesem Tag im Dezember aber sehe
ich etwas anderes. Ich sehe das Licht.
Es ist gelb, wie das meiste Licht in einer Winterstadt; es hat geschneit,
und deshalb hat es, auch wenn es nur ein zartes Licht ist, einen starken
Widerschein. Es scheint unten bei einem der Packhäuser, den Speichern,
die sie, als sie unsere Wohnblocks bauten, in einem schwachen Moment beschlossen
haben stehenzulassen. Auf der Giebelseite, zur Strandgade und nach Christianshavn
zu, rotiert das Blaulicht eines Streifenwagens. Ich sehe einen Polizisten.
Die provisorische Absperrung aus weiß-roten Plastikbändern.
Das, was dort abgesperrt ist, kann ich als kleinen dunklen Schatten auf
dem Schnee ausmachen.
Weil ich renne und es erst gut fünf Uhr und der Nachmittagsverkehr
noch nicht vorbei ist, schaffe ich es, einige Minuten vor dem Krankenwagen
dort zu sein.
Jesaja liegt mit angezogenen Beinen da, das Gesicht im Schnee und die
Hände um den Kopf, als wollte er sich gegen den kleinen Scheinwerfer,
der ihn beleuchtet, abschirmen, als sei der Schnee ein Fenster, durch
das er tief unter der Erde etwas gesehen hat.
Der Polizist müßte mich sicher fragen, wer ich bin, meinen
Namen und meine Adresse aufnehmen und überhaupt die Arbeit der Kollegen
vorbereiten, die jetzt bald von Haus zu Haus gehen und klingeln müssen.
Aber er ist ein junger Mann mit einem kranken Ausdruck in den Augen. Er
vermeidet es, Jesaja direkt anzuschauen. Als er sich vergewissert hat,
daß ich sein Absperrband nicht übertrete, läßt er
mich stehen.
Er hätte ein größeres Stück absperren können.
Doch das hätte keinen Unterschied gemacht. Die Packhäuser werden
teilweise umgebaut. Menschen und Maschinen haben den Schnee hartgetrampelt
wie einen Terrazzoboden.
Selbst im Tod hat Jesaja etwas Abgewandtes, als wollte er von Mitleid
nichts wissen.
Hoch oben, außerhalb des Scheinwerferlichts, ahnt man einen Dachfirst.
Das Packhaus ist hoch, sicher so hoch wie ein sieben- oder achtstöckiges
Wohnhaus. Das angrenzende Haus wird umgebaut. An der Giebelseite, die
auf die Strandgade hinausgeht, steht ein Gerüst. Dort gehe ich hin,
während sich der Krankenwagen über die Brücke arbeitet
und dann zwischen den Gebäuden durchwindet.
Das Gerüst deckt die Giebelseite bis zum Dach hinauf ein. Die untere
Leiter ist heruntergeklappt. Die Konstruktion scheint immer zerbrechlicher
zu werden, je höher man kommt.
Sie bauen ein neues Dach. Über mir türmen sich die dreieckigen
Dachsparren. Sie sind mit einer Persenning zugedeckt, die über die
halbe Gebäudelänge reicht. Die andere Hälfte, auf der Hafenseite,
ist eine verschneite Fläche. Darauf sind die Spuren von Jesaja.
An der Schneekante hockt ein Mann, der seine Knie umklammert hält
und sich hin und her wiegt. Selbst zusammengekauert wirkt der Mechaniker
noch groß, und noch in dieser Haltung totaler Resignation wirkt
er zurückhaltend.
Es ist so hell. Vor einigen Jahren hat man das Licht bei Siorapaluk gemessen.
Von Dezember bis Februar, drei Monate, in denen die Sonne weg ist. Man
stellt sich immer eine ewige Nacht vor, aber es sind Mond und Sterne da,
und ab und zu das Nordlicht. Und der Schnee. Man registrierte dieselbe
Anzahl Lux wie außerhalb von Skanderborg in Jütland. Genau
so erinnere ich meine Kindheit. Daß wir immer draußen spielten,
und daß es immer hell war. Damals war das Licht eine Selbstverständlichkeit.
So viele Dinge sind für ein Kind selbstverständlich. Mit der
Zeit fängt man dann an, sich zu wundern. Jedenfalls fällt mir
auf, wie hell das Dach vor mir ist. Als sei es die ganze Zeit über
der in einer vielleicht zehn Zentimeter dicken Schicht liegende Schnee
gewesen, der das Licht dieses Wintertages geschaffen hat, und als glühe
es in punktweisem Glitzern wie kleine, graue, leuchtende Perlen immer
noch nach. Am Boden schmilzt der Schnee ein bißchen, selbst bei
schwerem Frost, wegen der Wärme der Stadt. Hier oben jedoch liegt
er locker, so wie er gefallen ist. Nur Jesaja hat ihn betreten.
| Buchtipp |
 |
Selbst wenn keine Wärme da ist, kein neuer Schnee, kein Wind, selbst
dann verändert sich der Schnee. Als würde er atmen, als würde
er sich verdichten, sich heben und senken und sich zersetzen.
Jesaja hat Turnschuhe getragen, auch im Winter, und es ist seine Spur,
die abgetretene Sohle seiner Basketballstiefel mit der gerade noch sichtbaren
Zeichnung konzentrischer Kreise unter der Wölbung der Fußsohle,
um die sich der Spieler drehen muß. Er ist dort, wo wir stehen,
in den Schnee hinausgetreten. Die Spuren laufen schräg auf die Dachkante
zu und führen daran entlang weiter, vielleicht zehn Meter. Dann halten
sie an. Um sich dann zur Ecke und zur Giebelseite hin fortzusetzen. Wo
sie der Dachkante in einem Abstand von ungefähr einem halben Meter
bis an die Ecke zum angrenzenden Packhaus hin folgen. Von dort aus ist
er vielleicht drei Meter zur Mitte zurückgelaufen, um Anlauf zu nehmen.
Dann führt die Spur direkt zur Kante, wo er gesprungen ist.
Das andere Dach besteht aus glasierten schwarzen Ziegeln, die zur Dachrinne
hin in so steilem Winkel abfallen, daß der Schnee nicht liegengeblieben
ist. Es gab nichts zum Festhalten. So gesehen hätte er ebensogut
direkt in den leeren Raum springen können. Außer Jesajas Spuren
gibt es keine anderen. Auf der Schneefläche ist außer ihm niemand
gewesen.
"Ich habe ihn gefunden", stellt der Mechaniker fest.
Es wird für mich nie leicht sein, Männer weinen zu sehen. Vielleicht,
weil ich weiß, wie fatal das Weinen für ihre Selbstachtung
ist. Vielleicht, weil es für sie so ungewohnt ist, daß es sie
immer in ihre Kindheit zurückverfrachtet. Der Mechaniker ist in dem
Stadium, wo er es aufgegeben hat, sich die Augen zu trocknen, sein Gesicht
ist eine Maske aus Schleim.
"Putz dir die Nase", sage ich. "Es kommen Leute."
Die beiden Männer, die aufs Dach kommen, sind über unseren Anblick
nicht sonderlich erfreut.
Der eine schleppt die Fotoausrüstung und ist außer Atem. Der
andere erinnert ein wenig an einen verwachsenen Nagel. Flach und hart
und voll ungeduldiger Gereiztheit.
"Wer sind Sie?"
"Die Nachbarin von oben", sage ich. "Und der Herr ist der
Mann von unten."
"Gehen Sie bitte runter."
Dann sieht er die Spuren und ignoriert uns.
Der Fotograf macht die ersten Bilder, mit Blitz und einer großen
Polaroidkamera.
"Nur die Spuren des Verstorbenen", sagt der Nagel. Er redet,
als fertige er im Kopf bereits seinen Bericht an. "Die Mutter betrunken.
Da hat er halt hier oben gespielt."
Dann fällt sein Blick erneut auf uns.
"Gehen Sie jetzt bitte runter."
Zu diesem Zeitpunkt sehe ich nichts klar, es geht alles durcheinander.
Das allerdings so sehr, daß ich davon abgeben kann. Ich bleibe also
stehen.
"Komische Art zu spielen, nicht wahr?"
Manche Leute meinen vielleicht, ich sei eitel. Das will ich eigentlich
nicht abstreiten. Ich kann ja auch Gründe dafür haben. Jedenfalls
ist es meine Kleidung, die ihn jetzt zuhören läßt. Der
Kaschmir, die Pelzmütze, die Handschuhe. Er hat zwar Lust und auch
das Recht, mich hinunterzuschicken. Aber er sieht, daß ich aussehe
wie eine Dame. Auf den Dächern von Kopenhagen begegnet man nicht
so vielen Damen.
Einen Augenblick lang zögert er also.
"Wieso?"
"Als Sie in dem Alter waren", sage ich, "und Vater und
Mutter noch nicht aus dem Kohlenbergwerk zurück waren und Sie allein
auf dem Dach der Obdachlosenbaracke gespielt haben, sind Sie da in gerader
Linie die Dachkante entlanggelaufen ?"
Daran kaut er ein wenig.
"Ich bin in Jütland aufgewachsen", sagt er dann. Doch sein
Blick läßt mich nicht los, während er das sagt.
Dann dreht er sich zu seinem Kollegen um.
"Wir brauchen Lampen hier oben. Und wenn du gleich noch die Dame
und den Herrn runterbringen würdest."
Danke an den Lübbe Verlag für die Veröffentlichungserlaubnis. |